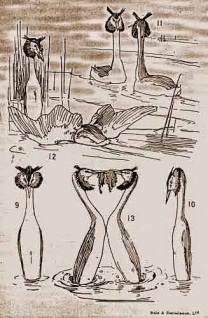Dohlen haben auf mich immer einen etwas listigen und verschlagenen Eindruck gemacht. Ihr scharfer, aber irgendwie indirekter Blick sowie ihre etwas ungelenke Fortbewegung am Boden sind wahrscheinlich der Grund dafür. Glücklicherweise werden Tierarten heute nicht mehr so vermenschlichend dargestellt, wie es noch zu Zeiten Alfred Edmund Brehms der Fall war.

Wie aber ticken Dohlen wirklich? Der Beantwortung dieser Frage sind nun Wissenschaftler der Universität Cambridge (Großbritannien) ein Stückchen näher gekommen. Ihr Interesse galt der Frage, inwieweit diese Vögel, denen man wie allen Rabenvögeln im Allgemeinen eine nicht zu unterschätzende Intelligenz zubilligt, menschliche Gesichter und eine eventuell von diesen ausgehende Bedrohung wahrnehmen können.
Gabrielle Davidson vom Psychologie-Department der renommierten britischen Gelehrtenschmiede verwendete zwei verschiedene Typen von Masken: die eines langhaarigen, jüngeren Mannes sowie die eines älteren, glatzköpfigen Mannes (wäre die Wissenschaftlerin mit diesen Masken in der Fußgängerzone einer beliebigen Stadt herumgelaufen, hätte sie vermutlich nicht wenige Zeitgenossen in die Flucht geschlagen; hier aber ging es ja um die Wirkung auf Vögel!). Die eine („neutrale“) Maske verwendete sie nur, wenn sie scheinbar absichtslos am Nistkasten der grau-schwarzen Vögel vorbeischlenderte. Die andere (die „Drohmaske“) jedoch zog sie sich nur dann über den Kopf, wenn sie die Nistkästen öffnete und die bereits geschlüpften Jungen herausnahm und ihr Gewicht maß und dokumentierte. Letzteres war eine schwerwiegende Störung, und es wurde dafür gesorgt, dass sich die Elternvögel die bei diesen Tätigkeiten getragene Maske einprägen konnten.
Nachdem die Vögel auf diese Weise die Gelegenheit gehabt hatten, bestimmte Erfahrungen mit den jeweiligen Masken zu verknüpfen, wurden im Folgenden die eigentlichen Exeperimente gestartet: die Forscherin bewegte sich mal mit der einen, mal mit der anderen Maske auf den Nistkasten zu. Es zeigte sich, dass die Dohlen beim Erscheinen der Drohmaske – offensichtlich zum Zwecke der Verteidigung ihrer Jungen – schneller zum Nistplatz zurückflogen als beim Sichtbarwerden der neutralen Maske. Das wird von der Cambridger Arbeitsgruppe als Hinweis darauf gewertet, dass Dohlen ihre möglichen Raubfeinde (Prädatoren) individuell am Gesicht unterscheiden können – zumindest, wenn es sich dabei um Menschen handelt.
Weiterhin experimentierten die Forscher mit zwei zusätzlichen Masken, die den bisher eingesetzten ähnlich sahen, allerdings eine andere Blickrichtung simulierten. Es zeigte sich, dass die Blickrichtung des Menschen (d.h. des potentiellen Feindes der Vögel) in unmittelbarer Nöhe des Nistplatzes zwar eine gewisse Rolle spielt – es gab eine Tendenz der Vögel, den direkten Blick als bedrohlicher zu empfinden als den abgewendeten Blick – , doch diese Resultate waren nicht signifikant.
Bleibt festzustellen: nicht nur „Facebook“ kann Gesichter erkennen – auch Dohlen können das! Und das kann sich auszahlen: Das individuelle Erkennen eines Prädators, der bereits als potentiell gefährlich wahrgenommen wurde, kann Schlimmeres verhindern. Und somit staunt man einmal mehr über die Cleverness der Dohlen.

Literatur: